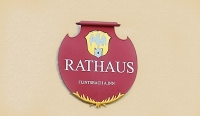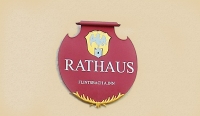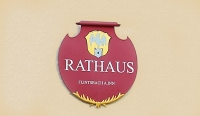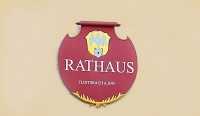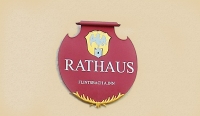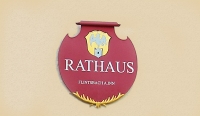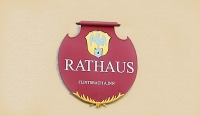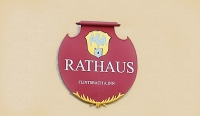Das Schwimmbad ist ab Freitag, 2. Mai 2025 bei guter Witterung ab 10 Uhr geöffnet!
Die Gemeindeverwaltung ist am Freitag, 2. Mai 2025 geschlossen!
Information über das FFH-Artenmonitoring von 2025 bis 2028
Information über das FFH-Artenmonitoring von 2025 bis 2028
Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (Monitoring).
Gemäß Art. 17 der FFH-RL erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht, der die wichtigsten Ergebnisse dieses Monitorings integriert. Die Europäische Kommission bewertet auf der Grundlage dieser Berichte die Fortschritte bei der Verwirklichung in der FFH-RL genannter Ziele.
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhaltungszustand der Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten in Deutschland über ein Stichprobenverfahren zu ermitteln und zu dokumentieren.
Das Monitoring der Insekten-, Pflanzen-, Amphibien und Reptilienarten erfolgt in Bayern an festen Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht werden müssen.
Die Probeflächen können sowohl innerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen.
In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens eine Probefläche einer oder mehrerer der genannten Artengruppen.
Diese Probefläche soll im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt von April 2025 bis Oktober 2028 begangen und bewertet werden.
Die Untersuchungen haben keinerlei Konsequenzen für die Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten und führen auch nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke.
Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten des Offenlands ist das Bayerische Landesamt für Umwelt.
Für Wald-Lebensraumtypen und manche Arten ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zuständig.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutzbehörde beim zuständigen Landratsamt bzw. bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung.
Informationen zum Sturzflut-Risikomanagement mit Links
Informationen zum Sturzflut-Risikomanagement mit Links zu Animationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Flintsbach a.Inn unter der Rubrik "Aktuelles" - "Sturzflut-Risikomanagement"
Vergabe von "Bauland für Einheimische"
Im Bereich des Baugebiets "An der Aribonenstraße" werden von der Gemeinde Flintsbach a.Inn insgesamt vier Baugrundstücke im Rahmen von "Bauland für Einheimische" nach den Richtlinien für die Vergabe von preisvergünstigten Wohnbaugrundstücken an einkommensschwächere Personen vergeben.
Der Kaufpreis beträgt 475 €/m² zuzüglich Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal.
Bewerbungsunterlagen können ab sofort bei der Gemeinde Flintsbach a.Inn, Kirchstraße 9, 83126 Flintsbach a.Inn, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! angefordert werden.
Die Bewerbunsfrist endet am 30. Juni 2025.
Informationen zum Grundsteuerbescheid
Hinweise zu Einwendungen und Rechtsbehelfen
Ab 2025 wird die Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes (GrStG) und des Bayer. Grundsteuergesetz (BayGrStG) i.V.m. der Abgabenordnung (AO) i.V.m. der Hebesatzung der Gemeinde Flintsbach a.Inn vom 25.09.2024 festgesetzt und erhoben.
Die Grundsteuerbescheide wurden im Dezember 2024 zugestellt.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass Einwendungen, die sich gegen den Grundsteuermessbescheid richten, gegenüber dem zuständigen Finanzamt geltend zu machen sind. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs (weder beim Finanzamt noch bei der Gemeinde) hat keine zahlungsaufschiebende Wirkung. Die Wirksamkeit des Grundsteuerbescheides wird durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht gehemmt, insbesondere wird die Einziehung der angeforderten Steuer nicht aufgehalten.
Die Steuerschuld ist mit den ausgewiesenen Beträgen zu den angegebenen Terminen zur Zahlung fällig. Wird die Steuer nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, fallen für jeden angefangenen Monat der Säumnis nach § 240 AO Säumniszuschläge kraft Gesetzes an. Zusätzlich können Mahn- und Vollstreckungskosten entstehen, die vom Steuerschuldner zu tragen wären. Sollte sich der Steuermessbetrag und damit die Grundsteuerschuld verringern, werden wir eine ergebende Erstattung/Guthaben Ihrem Konto unaufgefordert gutschreiben, sofern keine offenen Forderungen zur Verrechnung bestehen.
Neufassung der "Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages"
Der Gemeinderat hat eine Neufassung der „Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages der Gemeinde Flintsbach a.Inn“ beschlossen.
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Neufassung der "Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren"
Die Gemeinde hat eine Neufassung der „Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren“ beschlossen.
Die Bekanntmachung wurde an die Amtstafel angeheftet am 31.10.2024. Die Satzung tritt somit am 01.11.2024 in Kraft.
Hinweis zur Berechnung der Grundsteuer ab 01.01.2025
Mit der Reformierung der Grundsteuer zum 01.01.2025 ändert sich auch die Berechnungsgrundlage. Da die bisherigen Hebesätze mit Ende des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, d.h. zum 01.01.2025 automatisch ihre Geltung verlieren, muss jede Gemeinde die ab dem 01.01.2025 gültigen neuen Hebesätze noch im Kalenderjahr 2024 festlegen.
Der Gemeinderat hat sich in den öffentlichen Sitzungen vor und nach der Sommerpause mit dieser Thematik auseinandergesetzt und beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 320 v.H. und für die Grundsteuer B mit 320 v.H. nicht zu ändern.
Nach Durchsicht der vom Finanzamt mitgeteilten Messbeträge ab dem 01.01.2025 haben wir festgestellt, dass es zum Teil zu hohen Differenzen gegenüber der ursprünglichen Festsetzung gibt. Diese Differenz kann zwar durchaus korrekt sein, aber wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Bescheid vom Finanzamt nicht richtig ist, müssen Sie sofort tätig werden, weil die Gemeinde zwingend an die Grundsteuermessbetragsbescheide des Finanzamts gebunden ist. Die Gemeinde muss den vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbetrag als Grundlage zur Berechnung der Grundsteuer verwenden.
Die Gemeinde multipliziert den Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz der Gemeinde.
Beispiel:
Grundsteuermessbetrag z.B. 100,00 EUR x Hebesatz 320 % = 320,00 EUR Grundsteuer/Jahr.
Gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinde können Sie nur noch einen Widerspruch wegen dem angewandten Hebesatz bzw. formellen Fehlern einlegen. Korrekturen bezüglich der Grundstücks-, Wohn- oder Nutzflächen können nur über das Finanzamt vorgenommen werden. Wir bitten Sie deshalb, in Ihrem eigenen Interesse, die vom Finanzamt erhaltenen Messbescheide zu überprüfen. Innerhalb der Rechtsbehelfsfrist nach Zustellung des Bescheides vom Finanzamt können Sie beim Finanzamt Einspruch einlegen (siehe Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Bescheid). Aber auch wenn die Frist für den Rechtsbehelf abgelaufen ist, müssen Sie Fehler beim Finanzamt schriftlich anzeigen.
Die bayerischen Vordrucke „Grundsteueränderungsanzeige (BayGrSt5)“ und die dazugehörige Ausfüllanleitung liegen in den Finanzämtern aus und sind auf www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von Änderungen“, Wie kann ich Änderungen beim Finanzamt anzeigen?“ abrufbar. Weitere wichtige Informationen finden Sie auf https://www.grundsteuer.bayern.de/.
Die Grundsteuerbescheide werden von der Gemeinde voraussichtlich bis zum Jahresende versandt.
Nachfolgend die ab 01.01.2025 gültige „Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Flintsbach a.Inn (Hebesatzsatzung)“:
Stellungnahme der Gemeinde zum Scoping-Verfahren gemäß § 15 UVPG
Das Eisenbahn-Bundesamt führt für den „Brenner-Nordzulauf, ABS/NBS 36 München-Rosenheim-Kiefersfelden-Grenze D/A (-Kufstein)“ ein Scoping-Verfahren durch. Die Vorhabensträgerin DB InfraGO AG (ehem. DB Netz AG) hat am 25.04.2022 einen Antrag nach § 15 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) auf Unterrichtung über Inhalt, Umfang und Detailtiefe der Angaben, die in den Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen (UVP-Bericht) für das Vorhaben aufzunehmen sind, gestellt. Der Gemeinde wurde Gelegenheit gegeben, sich an der Abstimmung über den voraussichtlichen Untersuchungsumfang für die o.g. Maßnahme zu beteiligen.
Nachfolgend die Stellungnahme der Gemeinde:
Ankündigung von Kartierungsarbeiten für den Brenner-Nordzulauf
Bekanntmachung der DB InfraGO:
Ab August 2024 bis voraussichtlich 2028 werden Umweltkartierungen im Gemeindebereich Flintsbach a.Inn erfolgen. Für die Berücksichtigung des Artenschutzes sowie von Naturschutzaspekten in den Genehmigungsverfahren sind detaillierte Bestandserfassungen der Tier- und Pflanzenarten sowie der Gewässer erforderlich. Die Kartierungen dienen dazu, Aufschluss über relevante Aspekte des Artenschutzes, des Naturschutzes und der Oberflächengewässer zu erhalten.
Im Anhang finden Sie die ausführliche Ankündigung sowie eine Karte und eine Aufstellung der betroffenen Grundstücke.
Entscheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshof zum Einsatz von Drohnenbefliegung zur Ermittlung der Geschossflächen
Wie auch andere bayerische Gemeinden in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführt, hat die Gemeinde Flintsbach a.Inn im Herbst die Grundstücke im Gemeindegebiet mit Drohnen befliegen lassen, um die Geschossfläche der Gebäude zur Neuberechnung der Herstellungsbeiträge, insbesondere zur Erhebung eines Verbesserungsbeitrags für die neue Trinkwasserleitung, zu ermitteln.
Der BayVGH hat nunmehr aufgrund einer Klage eines Bürgers aus der Gemeinde Neumarkt St. Veit, die ebenfalls diese Methode anwenden wollte, mit Beschluss vom 15.02.2024 entschieden, dass die Erhebung und Speicherung von Drohnenaufnahmen zur Durchführung der Beitrags- und Gebührenerhebung rechtswidrig ist. Der 4. Senat am BayVGH sieht hierfür keine Ermächtigungsgrundlage und folglich in den kommunalen Satzungen auch keine dem folgende Befugnis.
Für die Kalkulation ist aber eine belastbare Geschossflächenermittlung erforderlich. Als Alternativen stehen nur die Selbstauskunft, die aber erfahrungsgemäß aufgrund des schwachen Rücklaufs nicht praxistauglich ist, oder Messungen vor Ort, bei denen aber auch der Schutz der Privatsphäre auf der Strecke bleibt, zur Verfügung. Die Verwaltung hat alternativ auch Angebote für die Begehung der Grundstücke durch externe Firmen eingeholt. Der Gemeinderat war sich jedoch einig, dass eine Befliegung nicht nur weniger Zeit in Anspruch nimmt, was sich auch unmittelbar in den Kosten für die Maßnahme widerspiegelt, sondern auch einen geringeren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Grundstückseigentümer/Bewohner darstellt. Die Drohnenbefliegung ist auch für die Betroffenen weniger aufwendig, weil sie nicht, wie im Falle einer Begehung durch Dritte, zu Hause anwesend sein müssen.
Da das Bayer. Datenschutzgesetz gemäß dem Urteil des BayVGH nicht als Rechtsgrundlage ausreicht, klärt der Bayer. Gemeindetag derzeit auch mit dem Staatsministerium des Innern, ob hierfür eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden kann.
Der Gemeinde liegen die Drohnenaufnahmen nicht vor. Wir haben sowohl mit der beauftragten Firma als auch mit dem Bayer. Gemeindetag Kontakt aufgenommen, um die Angelegenheit rechtlich klären zu lassen und entsprechend abzuwickeln.
Bildergalerie "Almbauerntag in Flintsbach" 7./8. Oktober 2023
76. Almbauerntag in Flintsbach - Ein Ereignis, das in Flintsbach seit 37 Jahren nicht mehr stattgefunden hat! Der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern, der rund 770 Almbetriebe mit über 350 Mitarbeitern vertritt, bewirtschaftet Almflächen zwischen 600 und 2400 Metern über dem Meeresspiegel im oberbayerischen Gebirgsraum. Diese Flächen erstrecken sich über etwa 18.000 Hektar zwischen dem Berchtesgadener Land und Garmisch-Partenkirchen.
Am Samstag, 7. Oktober fand im Festzelt der traditionelle Heimatabend mit örtlichen Musik-, Plattler- und Gesangsgruppen statt. Moderiert wurde der Festabend von Maria Gasteiger.
Der Festsonntag am 8. Oktober begann mit einem Standkonzert der Musikkapelle Flintsbach. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin ging der Festzug zum Zelt an der Wendelsteinstraße. Die Flintsbacher Ortsvereine (Musikkapelle, Trachtenverein, Feuerwehr, Gebirgsschützen), Ehrengäste, Vorstandschaft des Almwirtschaftlichen Vereins, Almbauern, Nachbars-Trachtenvereinen Brannenburg und Degerndorf sowie der Musikkapelle Brannenburg boten ein prächtiges Bild. Brannenburger Kinder mit Schafen, Esel, Hühnern und Kälbern ernteten großen Applaus bei den Zuschauern.
Mitteilung des Landratsamtes Rosenheim: Digitaler Bauantrag möglich
Mehr Bürgerfreundlichkeit, weniger Bürokratie:
Digitaler Bauantrag bald auch am Landratsamt Rosenheim möglich
Bei der Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts Rosenheim können ab 01.11.2023 Bauanträge auch digital eingereicht werden.
Im Landratsamt Rosenheim wurden im zurückliegenden Jahr 1.651 Bauanträge bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht und bearbeitet. Künftig ist dies auch digital möglich. Landrat Otto Lederer zeigt sich erfreut über das neue Angebot: „Diese neue, innovative Lösung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in Richtung Digitalisierung. Dieser Weg bedeutet nicht nur eine enorme Erleichterung für Bauherren und Planer, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, dass die Testphase erfolgreich war und wir nun diesen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer modern organisierten und bürgerfreundlichen Verwaltung gehen können.“
Der digitale Bauantrag ermöglicht es, Bauanträge über ein Online-Formular direkt bei der Bauaufsichtsbehörde beim Landratsamt Rosenheim einzureichen. Auch die am Computer entworfenen Pläne können unmittelbar dem Online-Antrag angehängt werden. Beim Ausfüllen werden zahlreiche Hilfestellungen gegeben, zum Beispiel wird auf erforderliche Bauvorlagen hingewiesen. Dadurch kommt es zu geringeren Bearbeitungszeiten und die Bauanträge werden vollständiger. Für die Beratung von Bauherren oder Planern sind weiterhin die Gemeinden erste Ansprechpartner. Diese müssen auch im digitalen Genehmigungsprozess weiterhin ihr Einvernehmen erteilen. Für die Einreichung bzw. auch die Nachreichung von Unterlagen in digitaler Form wird die Authentifikation des jeweiligen Antragstellers durch die BayernID oder dem Unternehmenskonto auf ELSTER-Basis benötigt.
Ebenfalls Änderungen bei Antrag in Papierform
Natürlich bleibt die bisherige „analoge“ Antragstellung in Papierform weiterhin möglich. Doch auch hier gibt es zum 1. November eine Neuerung: Dann erfolgt das Einreichen sämtlicher Anträge, für die die Bauaufsichtsbehörde zuständig ist, direkt beim Landratsamt als zuständiger Bauaufsichtsbehörde. Dabei ist es egal, ob der Antrag digital oder analog eingereicht wird. Eine Ausnahme gibt es bei den Verfahren der Genehmigungsfreistellung und isolierte Befreiung, bei Ausnahmen von gemeindlichen Bebauungsplänen oder Satzungsabweichungen in Papier: Hier bleibt weiter die Gemeinde zuständig.
Diese Neuerung hat einen großen Vorteil: Bauherren müssen nun mit der Einreichung nicht erst auf die nächste Gemeinderatssitzung warten. Der Antrag wird nach der Erfassung im Landratsamt gleichzeitig durch die Bauaufsichtsbehörde, die beteiligten Fachbehörden und die Gemeinde bearbeitet. Analog eingereichte Anträge werden hierzu in der Behörde gescannt, um dann ebenso digital bearbeitet werden zu können. Hierdurch verspricht sich das Kreisbauamt insgesamt ein kürzeres Genehmigungsverfahren.
Digitaler Bauantrag als große Chance
Entwickelt wurde der Digitale Bauantrag für Bayern vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mit Unterstützung des Staatsministeriums für Digitales und des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern. Ziel ist es, den Anwendungsbereich sukzessive auszudehnen, bis der Digitale Bauantrag flächendeckend in Bayern zur Verfügung steht.
„Die Digitalisierung ist eine große Chance – für die Bürgerinnen und Bürger genauso wie für die Kommunen“, sagt Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. „Denn Bauanträge können dank des digitalen Verfahrens viel einfacher gestellt und bearbeitet werden. Ich freue mich, dass nun das Landratsamt Rosenheim dazukommt und damit schon 61 Städte und Landratsämter in Bayern den Digitalen Bauantrag anbieten. Zusammen sind das bereits mehr als zwei Drittel aller bayerischen Bauaufsichtsbehörden. Die Erfahrungen sind rundum positiv: Insgesamt sind an den bislang teilnehmenden Ämtern schon über 10.000 digitale Anträge eingereicht worden.“
Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach betont den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger: „Der digitale Bauantrag nimmt Fahrt auf. Es ist großartig, dass nun eine weitere Untere Bauaufsichtsbehörde diesen zeitgemäßen digitalen Bürgerservice anbietet. Damit bauen wir Barrieren für die Antragsteller ab und modernisieren die Bearbeitung der Anträge. Das ist fortschrittlicher Dienst am Kunden. Hier ist die kommunale Ebene gefordert, entsprechende Angebote zu machen, sodass hoffentlich bald die Beantragung dieser äußerst wichtigen Leistung in ganz Bayern möglich ist.“
Weitergehende Informationen sowie häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auf der Webseite des Landratsamtes Rosenheim unter www.landkreis-rosenheim.de. Fragen zur digitalen Bauantragsstellung richten Sie bitte an Frau Bruhnke unter der Durchwahl: -3121 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Brenner-Nordzulauf: Kernforderungen der Gemeinde
Die Gemeinde Flintsbach a.Inn stellt folgende „Kernforderungen“ zum Brenner-Nordzulauf:
- Die Verknüpfungsstelle in ihrer momentan geplanten Form ist abzulehnen.Die Gemeinde fordert mit Nachdruck die Verknüpfungsstelle im Berg und die Aufnahme der Verknüpfungsstelle Wildbarren in die Planungen der Deutschen Bahn. Diese grundsätzlichen Überlegungen (s. Anlage 1) sind der DB AG schon seit Jahren bekannt (Raumordnungsverfahren und nachfolgende Diskussionen). Nach aktuellem Gutachten einer renommierten Expertengruppe (s. Anlage 2) ist eine solche Lösung auch genehmigungsfähig.
- sofortiger Ausbau von Lärmschutz auf der Bestandsstrecke nach Neubaustandard;
- maximaler Schutz (über der gesetzlichen Norm) der Anwohner während der Bauphase vor Immissionen (keine 7 Tage/24 Stunden Bautätigkeit, Ruhezeiten von 22-6 Uhr und an Sonn- und Feiertagen) sind einzuhalten;
- maximaler Lärmschutz - ausgelegt auf die Maximalauslastung der Bahnstrecke - über den gesetzlichen Standard hinaus über den gesamten oberirdischen Streckenverlauf;
- der aktive Schallschutz ist aufgrund der besonderen Situation im Planungsgebiet ganzheitlich zu betrachten (enge Tallage, Autobahn und Staatsstraße als zusätzliche Lärmquellen); er ist nicht nur anhand der Grenzwerte der 16. BImSchV zu dimensionieren, sondern als
einzuhaltende Pegel sind die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anzusetzen;
- passive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzfenster) als Ersatz für „außerverhältnismäßige“ aktive Maßnahmen werden abgelehnt;
- keine Ausgleichsflächen im Inntal;
- kein Eingriff in die Wohnbebauung und private Grundstücke (befriedetes Besitztum);
- mehrere Bypässe zum Abtransport des Aushubmaterials zwischen den Tunnelöffnungen;
- möglichst geringer Flächenverbrauch für Baustelleneinrichtung und Aushubmaterial; vorrangige Inanspruchnahme staatlicher Flächen;
- keine Belastung der Ortschaften durch Liefer- und Abtransport-Verkehr mit LKWs; Abtransporte emissionsarm über Förderbänder und Schiene, ggf. über die Autobahn; für die Verladung auf die Schiene ist die bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen; der ggf. benötigte Verladebahnhof muss dann auf ohnehin benötigte Bauflächen, z.B. geplante Verknüpfungsstelle, eingerichtet werden. Keine weitere Inanspruchnahme von Flächen!
- Rückbau der Bestandsstrecke und lastenfreie Zuführung der Grundstücke an die Landwirtschaft